Adoleszenz: Wenn Jugendliche unzufrieden werden
In der Adoleszenz werden aus Kindern junge Erwachsene. Diese Phase ist für die Entwicklung zentral. Die Gehirnstruktur verändert sich, die Persönlichkeit wird ausgebildet. Kein Wunder, dass Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit «schwierig» sind. Auch für SZPI kann es helfen zu wissen, was mit Jugendlichen in dieser Phase geschieht.
Spricht man von rebellischen, aufmüpfigen Jugendlichen, ist meist von der Pubertät die Rede. Doch die Phase, in der wichtige Veränderungen des Gehirns geschehen, ist viel länger. Diese gesamte Phase nennt man Adoleszenz. Sie umfasst die späte Kindheit, die Pubertät und das frühe Erwachsenenalter, also etwa die Phase von 10 bis 24 Jahren.
Strukturellen Veränderungen
Das adoleszente Gehirn ist dynamisch, es durchläuft einen Reifungsprozess. Dabei geht es nicht um eine Veränderung des Gehirnvolumens; dieses erreicht bereits kurz nach der Geburt sein Maximum. Vielmehr geht es um strukturelle Veränderungen der verschiedenen Hirnareale. Zentral dabei ist der organisierte Rückbau von Nervenverbindungen (Synapsen). Das schadet dem Gehirn nicht im Gegenteil: während der Kindheit werden unzählige Synapsen gebildet. Einige davon benötigen wir später nicht mehr. Diese abzubauen und nur die relevanten Verbindungen zu behalten, steigert die Effizienz des Gehirns.
Das adoleszente Gehirn reift ungleichmässig
Man geht davon aus, dass zwei Areale für das typisch pubertierende Verhalten ausschlaggebend sind: das limbische System und der präfrontale Kortex. Das limbische System, das für Belohnung und Emotionen verantwortlich ist, reift deutlich früher als die präfrontalen Areale, die vernünftiges Handeln steuern. So kommt es, dass Jugendliche tendenziell emotionaler reagieren und ihr Verhalten stärker auf Belohnungen in Form von sogenannten «Glückshormonen» auslegen. Diese werden beispielsweise beim Konsum von Suchtmitteln oder risikoreichen Aktivitäten ausgeschüttet. Die Vernunft hingegen ist vorerst gehemmt. Die Areale, die für rationale Entscheidungen und Impulskontrolle zuständig sind, kommen erst in der späteren Adoleszenz zum Tragen.
Lebenszufriedenheit nimmt ab
Auch die Psyche verändert sich während der Adoleszenz. Das hat Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die psychische Gesundheit der Jugendlichen. Eine kürzlich veröffentliche Studie der University of Cambridge (GB) untersuchte die Lebenszufriedenheit während der Adoleszenz. Die Forschenden stellten fest, dass die Lebenszufriedenheit in dieser Lebensphase zunächst rapide abnimmt, gegen ende der Adoleszenz aber wieder auf das vorherige Niveau ansteigt. Dieser Prozess ist ein universelles Phänomen und tritt in Daten aus unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaftsschichten auf. Daher wird angenommen, dass nicht äussere Einflüsse, sondern die neuronalen Veränderungen in dieser Lebensphase dafür verantwortlich ist.
Wieso so unzufrieden?
Um Laufe der Adoleszenz verändert sich die Art und Weise, wie wir Situationen bewerten. Im Zuge der sozialen Neuorientierung während der Adoleszenz sehen wir das Leben zunehmend als Wettbewerb. Wir beginnen, uns an Andere zu orientieren und uns zu vergleichen. Ein Prozess, der bekanntermassen unzufrieden machen kann. Aus der britischen Studie wird ausserdem deutlich, dass in der Adoleszenz die subjektiv empfundene Lebensqualität abnimmt, während die soziale Unsicherheit wächst. Dieses Zusammenspiel kann unglücklich machen.
Während der Pandemie
Die Daten, die für die britische Studie verwendet wurden, stammen von 2018. Die Coronapandemie spielt für die Ergebnisse also keine Rolle. Ein weiterer Hinweis darauf, dass äussere Umstände nicht zwingend die Lebenszufriedenheit beeinflussen. Trotzdem ist bekannt, dass die psychische Gesundheit der Jugendlichen während der Pandemie gelitten hat. Erkrankungen wie Depressionen oder Angstzustände nahmen unter Adoleszenten zu. Sie sind von den Folgen der Pandemie stärker betroffen als andere Altersgruppen. Die Schweizer Jugend sorgt sich weniger um Corona als um ihre persönliche Situation. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Universität Bern, die 2900 Jugendliche zwischen 11 und 21 Jahren befragte. Nur gut 2 Prozent fürchten sich vor eine Ansteckung – mehr Sorgen bereiten die sozialen Auswirkungen der Pandemie. Rund ein Viertel der Befragten plagen Zukunftsängste besonders bezüglich Berufswahl und schulischem Leistungsdruck. Eltern wie auch Lehrpersonen oder SZPI können Jugendliche in dieser ohnehin nicht ganz einfachen Entwicklungsphase unterstützen. Es braucht viel Verständnis, aber auch Unterstützung in den Bereichen Lehrstellensuche, Selbstmanagement und Stressbewältigung. Wichtig ist auch, den Jugendlichen Wissen über psychische Erkrankungen zu vermitteln und genügend Räume zu schaffen, wo Jugendliche unter sich sein können.



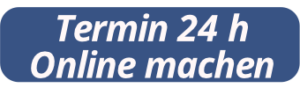

 Zahnarztpraxis Rafz – GmbH
Zahnarztpraxis Rafz – GmbH
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!