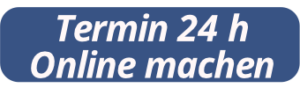Seit 2007 wurden die Empfehlungen zur Endokarditisprophylaxe deutlich reduziert. Die Auswirkungen dieser Deeskalation werden allerdings international nicht einheitlich bewertet. Daher lassen die deutschen Empfehlungen dem Zahnarzt/Arzt und der Zahnärztin/Ärtzin einen gewissen Rahmen für patientenindividuelle Entscheidungen.
Die Erstbeschreibung der infektiösen Endokarditis durch Sir William Osler geht bereits auf das Jahr 1885 zurück [Osler, 1885]. Die ursprünglich durchgehend letale Erkrankung bleibt auch 135 Jahre später ein sehr ernsthaftes Krankheitsbild mit einer hohen frühen, aber auch mittelfristigen Mortalität um 20 bis 30 Prozent [Jung & Duval, 2019]. In Westeuropa liegt die jährliche Inzidenz heute um 35/1.000.000 Einwohner, wobei der Altersgipfel in der siebten und in der achten Lebensdekade zu finden ist [Selton-Suty et al., 2012, Thornhill et al., 2018].
Besondere Risiken bestehen nach Herzklappenersatz, implantierten kardialen Geräten und vorausgegangener Endokarditis mit jährlichen Inzidenzraten bis über 10/1.000. Diese Risikogruppen sind in Europa mittlerweile für gut ein Drittel aller infektiösen Endokarditiden verantwortlich. Darüber hinaus sind angeborene und vor allem degenerative Klappenveränderungen im hohen Lebensalter bedeutsam. In Japan entstehen sogar zwei Drittel aller Endokarditiden auf der Grundlage vorbestehender Herzerkrankungen [Nakatani et al., 2013]. Im Gegensatz hierzu wird das Ursachenspektrum in Ländern mit niedrigem Einkommen und niedrigen medizinischen Versorgungsstandards von Herzklappenschädigungen nach rheumatischem Fieber und angeborenen Herzfehlern dominiert, so dass der Erkrankungsgipfel hier bei jungen Erwachsenen liegt. Die weltweite Mortalität lag 2013 bei 1/100.000 [GBD, 2013].
PATHOGENESE UND KLINIK DER ENDOKARDITIS
Die Pathogenese der Endokarditis beinhaltet drei wesentliche Prozesse [Cahill et al., 2017]. Am Anfang der Entwicklung steht die Bakteriämie, wobei die typischen Eintrittspforten in der Mundhöhle, dem Gastrointestinaltrakt, den Harnwegen und der Haut liegen. Hinzu kommt die Vielzahl iatrogener Maßnahmen, beginnend bei Verweilkanülen und Kathetern bis zu invasiven Maßnahmen und Operationen. Der nächste Schritt der Pathogenese ist die Adhäsion von Mikroorganismen, die insbesondere durch vorbestehende Schädigungen der endothelialen Auskleidung mit Fibrinauflagerungen und Mikrothromben begünstigt wird. Schließlich folgt die mikrobielle Kolonisierung, die zusammen mit der Auflagerung weiteren thrombotischen Materials und inflammatorischen Reaktionen zur Ausbildung von Vegetationen führt. Hierbei spielt die Bildung von Biofilmen auf implantierten Fremdmaterialien eine wichtige Rolle, da die eingebetteten Mikroorganismen durch immunologische Abwehrprozesse und auch Antibiotika weniger angreifbar sind.
Die klinische Symptomatik ist variantenreich und wird bei subakuten und chronischen Formen vor allem durch rezidivierende Fieberschübe (aber auch subfebrile Temperaturen), Nachtschweiß, Abgeschlagenheit et cetera geprägt. Bei den akuten Verläufen stehen die akute Herzinsuffizienz, Embolisierungen und die Sepsis im Vordergrund [Raiani & Klein, 2020].
Die Diagnose wird anhand der sogenannten modifizierten Duke-Kriterien [Li et al., 2000] gestellt. In diesem Instrumentarium basieren die Major-Kriterien auf bakteriologischen Nachweisen in der Blutkultur und den Ergebnissen verschiedener Bildgebungsverfahren, insbesondere der Echokardiografie. Weitere Bildgebungsverfahren wie Cardio-CT und PET-CT sind in den vergangenen Jahren hinzugetreten. Unter den Minor-Kriterien finden sich neben den klassischen kardialen Risiko-Prädispositionen Fieber, vaskuläre und immunologische Phänomene sowie serologische Infektionsnachweise.
Die wesentlichen Säulen der Therapie sind die langzeitige (vier bis sechs Wochen!) hochdosierte intravenös-antibiotische Behandlung und bei schweren Verlaufsformen chirurgische Maßnahmen zur Ausräumung thrombotischen Materials, zur Entfernung von Fremdmaterialien und zur Wiederherstellung der Klappenfunktionen. Trotz aller therapeutischen Entwicklungen hat sich die Prognose der akuten Endokarditis in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verbessert. Die Mortalität in der frühen Behandlungsphase liegt heute noch bei rund 20 bis 30 Prozent [Raiani & Klein, 2020; Cahill & Prendergast, 2016].
MIKROBIOLOGIE DER ENDOKARDITIS
Zwischen 80 und 90 Prozent aller infektiösen Endokarditiden werden durch grampositive Kokken verursacht, wobei Staphylokokken (heute führend) und Streptokokken jeweils um 35 Prozent und Enterokokken zu gut zehn Prozent nachgewiesen werden können. Die HACEK-Gruppe (Hämophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella) machen weitere rund drei Prozent aus, gefolgt von Candida-Spezies und vielen anderen seltenen Erregern [Cahill & Prendergast, 2016]. Das Keimspektrum spiegelt die typischen Eintrittspforten der Infektionen (kutan, oral/oropharyngeal und enterogen).
KONZEPT DER ANTIBIOTISCHEN PROPHYLAXE
Das Konzept der antibiotischen Endokarditisprophylaxe basiert letztlich auf der Annahme, dass die Gabe eines Antibiotikums zum Zeitpunkt einer Prozedur, die mit einer Keimeinschwemmung verbunden ist, die Bakteriämie vermindern kann und damit die Wahrscheinlichkeit einer Endokarditis verringert wird [Dayer & Thornhill, 2018]. Nachdem aufgrund der Seltenheit der Endokarditis ein methodisch stringenter Nachweis in Form einer prospektiv randomisierten Interventionsstudie bereits durch die erforderlichen (fünf- bis sechsstelligen) Probandenzahlen nicht praktikabel ist und auch aus ethischen Gründen schwer zu realisieren wäre, wurden Empfehlungen, beispielsweise in Leitlinien, über die Erkenntnisse aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Betrachtungen abgeleitet. Wesentliche Ansätze hierbei waren:
- tierexperimentelle Untersuchungen, in denen Endokarditiden induziert und mittels Antibiotikaprophylaxe verhindert wurden [Durack & Petersdorf, 1973];
- Untersuchungen zur Häufigkeit und Intensität von Bakteriämien nach invasiven dentalen (und anderen) Prozeduren und die Verminderung/Vermeidung einer Bakteriämie unter Antibiotikaprophylaxe [Poveda-Roda et al., 2008; Lockhart et al., 2008; Lafaurie et al., 2019];
- Fallkontrollstudien zur Häufigkeit von Endokarditiden mit beziehungsweise ohne antibiotische Prophylaxe [Horstkotte et al., 1986];
- Registerstudien zur Häufigkeit bakterieller Endokarditiden mit beziehungsweise ohne antibiotische Prophylaxe bei Risikopopulationen [Tubiana et al., 2017];
- Registerstudien zur Häufigkeit bakterieller Endokarditiden vor und nach Änderungen bei Leitlinien [DeSimone et al., 2012; DeSimone et al., 2012a; Dayer et al., 2015; Thornhill et al., 2018; Garg et al., 2019; Quan et al., 2020].
ENTWICKLUNGEN BEI DER ENDOKARDITISPROPHYLAXE
Die Mundhöhle als Eintrittspforte von Keimen wurde erstmals 1909 postuliert [Horder, 1909; Cahill et al., 2017] und bereits 1923 wurde ein ursächlicher Zusammenhang zwischen invasiven Zahnbehandlungen und Endokarditis vermutet [Dayer & Thornhill, 2018; Cahill et al., 2017; Lewis & Grant, 1923]. Wenige Jahre später wurde die Bakteriämie von Streptokokken mittels Blutkulturen nach Zahnbehandlungen nachgewiesen [Dayer & Thornhill, 2018; Okell & Elliot, 1935]. Eine antibiotische Prophylaxe wurde erstmalig 1941 eingesetzt und bereits 1955 folgte
die erste grundlegende Empfehlung zur Endokarditisprophylaxe durch die American Heart Association (AHA) [Jones et al., 1955; Wilson et al., 2007], der mittlerweile neun Aktualisierungen folgten. Die Endokarditisprophylaxe stellte damit über Jahrzehnte den Prototyp der antibiotischen Prophylaxe in der Zahnheilkunde (und in der gesamten Chirurgie) dar und war als grundlegendes, regelrecht dogmatisches Konzept über lange Zeit „nicht hinterfragbar“.
Den Höhepunkt der antibiotischen „Intensität“ erreichte die Entwicklung im Zeitraum von 1957 bis 1960 mit mehrfachen parenteralen (bis zu 21) Medikamenten-Dosen über fünf Tage bei vielen Indikationen, auch bei moderaten und geringen Risiken. Danach wurden die Empfehlungen schrittweise deeskaliert bis zur aktuellen singulären präoperativen Gabe auch bei höchsten Risiken oder sogar dem gänzlichen Verzicht.
ZWEIFEL AN DEN PATHOGENETISCHEN ZUSAMMENHÄNGEN
Die Relevanz der antibiotischen Endokarditisprophylaxe in der Zahnheilkunde wurde etwa ab der Jahrtausendwende verstärkt infrage gestellt, nachdem wiederholt gezeigt werden konnte, dass nicht nur invasive Zahnbehandlungen, sondern auch Maßnahmen der Mundhygiene [Poveda-Roda et al., 2008; Lockhart et al. 2008; Zhang et al., 2013] und sogar das Kauen bei stark parodontal erkrankter Dentition zu einer Bakteriämie führen. Vor diesem Hintergrund einer kontinuierlichen Keimeinschleppung im täglichen Leben erschien es wenig plausibel, dass ein vergleichsweise seltenes Ereignis wie eine Zahnentfernung oder eine invasive Parodontalbehandlung zu einem relevanten Anteil an der Entstehung von Endokarditiden beitragen könne. Darüber hinaus wurde auch immer wieder das Schreckgespenst der Antibiotika-assoziierten Komplikationen, insbesondere der potenziell letalen Anaphylaxie beschworen [Farbod et al., 2007; Hafner et al., 2020]. Mitunter wurde postuliert, dass das Risiko des Versterbens an einer Amoxicillin-bedingten Anaphylaxie, verursacht durch die Prophylaxe, um ein Mehrfaches über dem Risiko der Endokarditis liegen würde [Ashrafian & Bogle, 2007].
Andererseits ließ sich ein Zusammenhang zwischen Zahnbehandlungen und dem Auftreten von Endokarditiden aber auch nicht abstreiten und war aus zahlreichen Fallkontrollstudien plausibel abzuleiten. Ein nach Gesichtspunkten der evidenzbasierten Medizin methodisch stringenter Nachweis in der Form einer prospektiv randomisierten Interventionsstudie lässt sich, wie bereits eingangs erwähnt, aus biometrischen und auch aus ethischen Gründen kaum realisieren und würde mit Wahrscheinlichkeit auch an der fehlenden Akzeptanz scheitern.
DIE ZEITENWENDE 2007/2008: NEUE EMPFEHLUNGEN
Mit der letzten Revision der Endokarditisprophylaxe-Empfehlungen der American Heart Association [Wilson et al., 2007] und der konzeptionell in großen Teilen inhaltsgleichen Adaptierung in vielen kontinentaleuropäischen Ländern [Habib et al., 2009] wurde die Endokarditisprophylaxe in diesen Ländern auf die Gruppe der Patienten mit hohem Endokarditisrisiko begrenzt.
Eine noch wesentlich radikalere Abkehr von der bisherigen Praxis setzte das staatliche Gesundheitssystem (NHS) Großbritanniens auf der Basis einer Empfehlung des National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) um. Unabhängig von der Risikoeinstufung wurde hier die Endokarditisprophylaxe im Zusammenhang mit zahnärztlichen Maßnahmen ab dem zweiten Quartal 2008 generell und später, ab 2016, in modifizierter Form „als Routinemaßnahme“ ausgesetzt. Einen weiteren Sonderweg beschreitet Japan seit dem Jahr 2017. Hier wird die Endokarditisprophylaxe bei hohen und moderaten Risiken empfohlen.
DIE „POSTMODERNE“: ZU DEN FOLGEN DER US-EMPFEHLUNGEN
Bereits nach wenigen Jahren wurden aus den USA Daten über die Folgen der geänderten Prophylaxestrategien publiziert, die auch im weiteren Verlauf reevaluiert und bestätigt wurden [DeSimone et al., 2012, 2015]. Danach hatte in den USA die Zahl der Endokarditisfälle, trotz einer deutlichen Reduktion der Indikationen zu einer antibiotischen Prophylaxe gemäß der Leitlinienänderung von 2007, nicht zugenommen. Methodisch wurde die Häufigkeit von Endokarditisfällen vor und nach der Publikation der AHA-Leitlinie durch die Arbeitsgruppe De Simone et al. anhand zweier unabhängiger Szenarien betrachtet. Zum einen wurden die Erkrankungsfälle aus einer geschlossenen Kohorte, dem sogenannten Rochester Epidemiology Project of Olmsted County, verfolgt. Hier handelt es sich um eine geografisch weitgehend isolierte Population, deren medizinische Daten im Rahmen des oben genannten Projekts longitudinal erfasst werden. Weitere Analysen verwendeten die Diagnosen der Nationwide Inpatient Sample Hospital Discharge Database. Hierbei handelt es sich um eine fortlaufende Erhebung von Patientendaten im Rahmen des sogenannten Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP), die mit rund acht Millionen Datensätzen pro Jahr etwa 20 Prozent des gesamten stationären Behandlungsaufkommens der USA umfasst und als weitgehend repräsentativ für die Gesamtheit der stationären Patientenversorgung in den USA gilt.
Sowohl in der Analyse von 2012 als auch in der Reevaluation von 2015 ergaben sich in diesen Szenarien keine Zunahmen in der Häufigkeit bakterieller Endokarditisfälle nach der Änderung der Prophylaxe-Empfehlungen. In der Datenerhebung des Rochester Epidemiology Project of Olmsted County lag die Erkrankungshäufigkeit an bakteriellen Endokarditiden von 2007 bis zuletzt 2013 niedriger als in den Zeiträumen vor der Änderung. Auch die Analysen der Daten der Nationwide Inpatient Sample Hospital Discharge Database gaben keine Hinweise auf eine Häufung von Endokarditisfällen nach der Deeskalation der Endokarditisprophylaxe, sondern im Gegenteil in der Langzeitbetrachtung tatsächlich sogar eine Reduktion der Endokarditis-Fallzahlen von 2003 bis 2011. Insofern hatten sich die in der Leitlinie 2007 formulierten Grundsätze in der praktischen Anwendung zunächst einmal bewährt.
Dennoch gab es auch kritische Bewertungen der Entwicklung in den USA, da sich der abnehmende Trend in der Inzidenz von Endokarditiden, der sich von 2003 bis 2007 und damit vor der Deeskalation der Endokarditisprophylaxe deutlich erkennen ließ, in der Folgezeit nach 2008 nur noch abgeschwächt fortgesetzt hat [Thornhill et al., 2018]. Allerdings ließ sich diese Trendwende nicht in der Gruppe der Patienten mit niedrigem Risiko erkennen. Da sich in dieser Gruppe die Leitlinienänderungen zur Prophylaxe am ehesten ausgewirkt hätten, stellen die Daten nach Meinung der Autoren die Grundsätze der aktualisierten Leitlinie nicht infrage.
Kanada
Im Gegensatz zu den USA ließ sich in Kanada über knapp eineinhalb Jahrzehnte eine deutliche Zunahme der Endokarditisinzidenz nachweisen, wobei Change-Point-Analysen den Wendepunkt der Entwicklung für das Jahr 2010 erkennen ließen [Garg et al., 2019]. Aus diesem „späten“ Wendepunkt (drei Jahre nach der Neuauflage der AHA-Leitlinie) und der Tatsache, dass der Anstieg vor allem die Hochrisikopopulation betrifft, deren Prophylaxe-Indikationen durch die Leitlinienänderungen gerade nicht betroffen waren, leiteten Garg et al. ab, dass der Anstieg der Endokarditishäufigkeiten nicht durch die Änderung der Leitlinienempfehlungen erklärt werden kann. Kritiker wenden allerdings ein, dass der über die Jahre gleichbleibende Anteil an Streptokokken-Endokarditiden und damit ein relevanter Anteil der Zunahme durchaus auf die Reduktion der Prophylaxe zurückgeführt werden kann. Tatsächlich müsste nämlich der Anteil dieser am ehesten oralen/odontogenen Keimflora zurückgehen, wenn andere Endokarditisursachen in den Vordergrund treten [Peterson & Crowley, 2019]. Auch der verspätete Anstieg spricht nicht unbedingt gegen einen Einfluss der Leitlinienänderung, da sich die Auswirkungen auf die Endokarditisrate, sowohl primär durch die Dauer der Implementierung als auch sekundär durch die Vergrößerung der Zahl von Hochrisikopatienten nach einem Erstereignis, erst mit Verzögerungen manifestieren. Darüber hinaus entsteht mit der Beschränkung der Prophylaxe-Indikation auf eine besondere Risikogruppe naturgemäß auch die Gefahr einer fehlerhaften Zuordnung von Patienten. Wird beispielsweise ein Patient mit einem hohen Endokarditisrisiko fehlerhaft der Gruppe mit niedrigem oder moderatem Risiko zugeordnet, erhält er nach der aktuellen Leitlinie keine Antibiotikaprophylaxe mehr. Damit würde sich ein solcher Zuordnungsfehler tatsächlich auswirken können. In der früheren Version der Leitlinie hätte ein solcher Fehler die Medikation nicht verändert, das heißt die frühere Leitlinienversion war „robuster“ gegen Fehler in der Klassifikation.
Großbritannien
In Großbritannien ist es seit dem vollständigen Verzicht auf eine routinemäßige Endokarditisprophylaxe zu einem deutlichen und hoch signifikanten Anstieg der Endokarditishäufigkeit gekommen; konkret hat die Inzidenz von 44,5/1.000.000 im Jahr 2007 auf 67,7/1.000.000 im Jahr 2017 und die Gesamtfallzahl von 2.268 (in 2007) auf zuletzt 3.746 (in 2017) zugenommen. Auch in Großbritannien blieb dabei der Anteil der Streptokokken-Endokarditiden über die Jahre gleich.
Während Dayer et al. bereits 2015 einen Wendepunkt der Entwicklung kurz nach der Entscheidung gegen die Endokarditisprophylaxe identifiziert hatten [Dayer et al., 2015], sehen Quan et al. im Jahr 2020 keinen singulären Wendepunkt, sondern eine Folge von Wendepunkten, teilweise vor und teilweise nach der Richtungsentscheidung [Quan et al., 2020]. Da die Bestimmungen der Wendepunkte in hohem Maße von den gewählten statistischen Modellparametern abhängig ist, ist es sehr schwierig zu bewerten, welche Aussage der Realität näher kommt, zumal in der Frage der Endokarditisprophylaxe mittlerweile exemplarisch die Glaubwürdigkeit des NICE auf dem Prüfstand steht und die ursprünglich wissenschaftliche Diskussion damit im Laufe der Zeit auch eine politische Dimension angenommen hat.
Tatsächlich veränderte das NICE seine eindeutige Position gegen eine zahnärztliche Endokarditisprophylaxe im Sommer 2016. Aus der Formulierung „Antibiotic prophylaxis against infective endocarditis is not recommended for people undergoing dental procedures“ wurde „Antibiotic prophylaxis against infective endocarditis is not recommended routinely for people undergoing dental procedures”. Diese Änderung entstand im zeitlichen Zusammenhang mit einer durch einen englischen Parlamentsabgeordneten unterstützten Petition von Angehörigen, deren Ehepartner durch Endokarditiden verstorben waren [Thornhill et al., 2016].
ZU GEFAHREN DURCH DIE ENDOKARDITISPROPHYLAXE
Ein wesentlicher Anlass, den Nutzen der Endokarditisprophylaxe zu hinterfragen, war traditionell die Furcht vor schweren Nebenwirkungen der eingesetzten Antibiotika, insbesondere die Erwartung einer hohen Rate schwerer anaphylaktischer Reaktionen auf Amoxicillin mit potenziell tödlichem Ausgang [Wilson et al., 2007; Naber et al., 2007]. Diese Bedenken schienen vor dem Hintergrund vermeintlich hoher Allergieraten um fünf bis zehn Prozent in vielen westlichen Industrieländern sehr plausibel und wurden auch bei anderen prophylaktischen Antibiotikaindikationen immer wieder mit Vehemenz vorgetragen.
Tatsächlich hat sich allerdings über nunmehr gut zwei Jahrzehnte bestätigt, dass die weitaus überwiegende Zahl vermeintlicher Penicillinallergien Fehldiagnosen darstellen, die durch primär fehlerhafte Zuordnung von Symptomen entstanden sind und in der Folgezeit nie ausgeräumt wurden. Mitunter werden solche vermeintlichen Allergiediagnosen mit der laienhaften Erwartung verbunden, anstelle des „alten“ Penicillins ein besseres, „modernes“ Antibiotikum zu erhalten. Die Bedeutung des „Besitzstands“ einer Penicillinallergie auch nach deren definitivem Ausschluss mittels kontrollierten Provokationsversuchen wurde beispielsweise daran deutlich, dass 70 Prozent der Probanden mit dem Wegfall der Allergiediagnose unzufrieden waren [Savic et al., 2019]. In anderen Studien zeigte sich eine Tendenz, widerlegte Penicillinallergie-Diagnosen wieder in die Krankengeschichte aufzunehmen [Rimavi et al., 2013].
Zur Bewertung von Risiken durch die Antibiotikaanwendungen im Zuge der Endokarditisprophylaxe hatten Thornhill und Dayer [Thornhill et al., 2015] die Daten des britischen National Health Service (NHS) hinsichtlich der unerwünschten Wirkungen und Komplikationen der antibiotischen Endokarditisprophylaxe ausgewertet. Nachdem es im NHS spezielle Verschreibungsformen für Amoxicillin beziehungsweise Clindamycin in Prophylaxe-Indikationen gibt, ließen sich prophylaxespezifische Komplikationen für Amoxicillin von 1980 bis 2014, das heißt über 34 Jahre und für Clindamycin bereits von 1969 bis 2014, das heißt über 45 Jahre auswerten [Thornhill et al., 2015]. Bei 2.961.900 Verschreibungen von Amoxicillin ist über 34 Jahre keine letale Komplikation nach Endokarditisprophylaxe beobachtet worden. Für Clindamycin ergaben sich über 45 Jahre bei 1.193.502 Verschreibungen 15 letale Komplikationen. Die Mehrzahl (13 von 15) dieser Todesfälle entstanden durch die für Clindamycin „typischen“ Clostridium-difficile-assoziierten gastrointestinalen Komplikationen. Für Frankreich wurden über einen Zeitraum von 31 Jahren weder für Amoxicillin noch für Clindamycin letale Komplikationen nach Endokarditisprophylaxe beobachtet [Cloitre et al., 2019]. Insofern ist davon auszugehen, dass die Gefahr letaler anaphylaktischer Reaktionen auf Amoxicillin im Rahmen der Endokarditisprophylaxe deutlich überschätzt wurde und für die Indikationsstellung keine Bedeutung haben sollte.
AKTUELLE EMPFEHLUNGEN IN DEUTSCHLAND
In einer Vielzahl von Ländern wurden die Empfehlungen der AHA-Leitlinienrevision weitgehend inhaltsgleich umgesetzt oder in lokale Leitlinienempfehlungen übernommen. Beispiele sind die Adaptation der European Society of Cardiology [Habib et al., 2009] oder auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung (DGK) und der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie [Naber et al., 2007]. Im Kern wurden die Indikationen zur Endokarditisprophylaxe auf die Patientengruppe mit hohem Risiko begrenzt (Tabelle 1) und gleichzeitig die Durchführung generell auf eine einmalige präoperative Gabe eines oralen Antibiotikums reduziert. Über diese Patientengruppe hinaus sieht die deutsche Adaptation der Leitlinie eine Indikation auch bei denjenigen Patienten, die gemäß der bisherigen Leitlinienempfehlung eine Prophylaxe erhalten hatten und diese Prophylaxe nach Absprache mit ihrem Arzt fortführen möchten.

Tab. 1 | Quelle: Kunkel, 2021

Tab. 2a | Quelle: Kunkel, 2021

Tab. 2b| Quelle: Kunkel, 2021
Grundsätzlich wird eine Endokarditisprophylaxe bei allen Maßnahmen, die zu einer Bakteriämie führen können, empfohlen. Konkret sind das sämtliche invasive Maßnahmen und solche, die mit Manipulationen an der Gingiva, der periapikalen Zahnregion oder mit Perforationen der oralen Mukosa einhergehen [Hafner et al., 2020; Naber et al., 2007].
Antibiotikum der ersten Wahl bleibt seit dem Jahr 1990 Amoxicillin, wobei als orale Dosierung eine Einzeldosis von 2 g (bei Kindern 50 mg/kg) 30 bis 60 Minuten vor dem Eingriff beziehungsweise vor der Behandlungsmaßnahme, die eine Bakteriämie verursachen kann, empfohlen wird. Clindamycin in einer Dosierung von 600 mg (bei Kindern 20 mg/kg) wird nur für den Fall einer Penicillinallergie empfohlen. Alternativen zum Clindamycin stellen Cephalexin 2 g (bei Kindern 50 mg/kg) und Clarithromycin 500 mg (bei Kindern 15 mg/kg) dar.
Sofern eine orale Einnahme nicht möglich ist, stellt Ampicillin 2 g i. v. (bei Kindern 50 mg/kg) das Medikament der ersten Wahl dar; als Alternative kommen in dieser Situation Cefazolin oder Ceftriaxon 1 g i. v. (bei Kindern 50 mg/kg) infrage. Im Fall einer Penicillinallergie stehen zur parenteralen Applikation Clindamycin 600 mg (bei Kindern 20 mg/kg), Cefazolin oder Ceftriaxon 1 g i. v. (bei Kindern 50 mg/kg) zur Verfügung. Cephalosporine sollten allerdings generell nicht gegeben werden, wenn zuvor bereits einmal eine Anaphylaxie, ein Angioödem oder Urtikaria nach Penicillingabe/Ampicillingabe beobachtet wurde.
ZUM WISSENSCHAFTLICHEN DISKURS
Trotz der zahlreichen Analysen aus der Versorgungssituation vor und nach 2007 zeichnet sich weiterhin keine einheitliche Bewertung zur Notwendigkeit der Endokarditisprophylaxe ab. Auch die Kontroverse, ob die grundlegenden Änderungen der Jahre 2007/2008 Auswirkungen hatten oder nicht [van den Brink et al., 2019; Charitos & Sinning, 2019], bleibt – trotz gravierender Unterschiede in der Entwicklung verschiedener Länder – ungelöst. Obwohl in den USA die Zahl der Neuerkrankungen auch nach 2007 weiter sinkt, ergeben sich dort bereits Unsicherheiten aus der Erkenntnis, dass sich der Rückgang verlangsamt hat. Die diametral entgegengesetzte Entwicklung in Großbritannien mit einer erheblichen Zunahme der Neuerkrankungen um rund 60 Prozent seit 2008 wird andererseits durch die Vertreter des NICE nicht als Hinweis auf eine Unterbehandlung durch den Wegfall der Endokarditisprophylaxe gewertet, sondern als Ausdruck einer insgesamt erhöhten Suszeptibilität für Endokarditiden in der alternden Bevölkerung mit kardiovaskulären Risiken angesehen.
Auch wenn die Gefahr schwerer und insbesondere letaler individueller Komplikationen der Endokarditisprophylaxe nach den oben genannten Analysen sicher nicht mehr relevant ist, bleibt naturgemäß bei jeder prophylaktischen Antibiotikaindikation die Frage nach den eventuellen Auswirkungen auf die Resistenzentwicklung in der Gesamtheit einer Population. Hier hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass entgegen früherer Annahmen auch bereits die einmalige Gabe eines Antibiotikums zu genetischen Veränderungen im Mikrobiom des Darmes führen kann [Zaura & Brandt, 2015]. Andererseits muss hinterfragt werden, ob die Endokarditisprophylaxe mit einem extrem kleinen, im Promillebereich gelegenen Anteil an allen humanen Antibiotika-Anwendungen allein schon aufgrund der Seltenheit einen relevanten Einfluss auf die globale Resistenzentwicklung nehmen kann.
EnDiesen Artikel als PDF erhalten
Quelle: https://www.zm-online.de/archiv/2022/10/zahnmedizin/endokarditisprophylaxe-entwicklungen-und-aktuelle-empfehlungen/